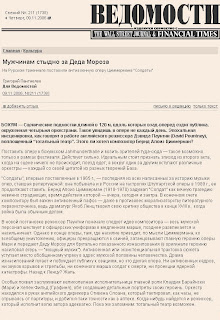In der – nicht besonders kontroversen – Diskussion um die Wirkung der neuen Synagoge in München hört man überwiegend positive Stimmen. Gibt es auch Bedenken? Kann es dabei überhaupt eine Kontroverse in Form eines Ja-Nein geben? Und wenn dem so ist, was steht zur Debatte? Bauen oder nicht bauen – das ist hier doch wahrlich keine Frage.
Ich begrenze die folgende imaginäre Diskussion in zweierlei Hinsicht. Lediglich zwei Stimmen reden miteinander: „Ja“ und „Ja, aber“. Zweitens dürfen sie sich nur über den Eindruck austauschen, der beim Anblick der neuen Synagogen in Deutschland von außen entsteht. Wie wirken sie auf einen Betrachter, bevor er eintritt?
Ja: Angesichts der Shoa und der Reichskristallnacht, der fast kompletten Zerstörung der Synagogen im Nazideutschland ist es eine Bringschuld der heutigen deutschen Politik, den angekommenen Juden die ungestörte Ausübung ihrer Religion wieder zu ermöglichen. Gemeinden werden wieder groß. Die meisten Städte verfügen über kleine und oft wenig passende Räume für den israelitischen Kultus. Es macht uns stolz, dass sich dies in den letzten Jahren ändert, denn viele neue Synagogen werden errichtet. Deren Einweihungen sind herausragende Ereignisse inmitten des politischen Alltags, die Bauten selbst gehören zu bedeutsamen Kunstwerken moderner Architektur. Will sagen: Was vor Jahrzehnten zerstört wurde, wird jetzt aufgebaut. Das jüdische Leben in Deutschland blüht abermals auf. Die neue Synagoge in München liegt zentral, ist unverkennbar exponiert, sie strahlt und lädt ein.
Ja, aber: Auch wenn es eine symbolisch starke Geste und eine großzügige Spende ist, bleibt die Frage nach der Außenwirkung. Wie kommt das an? Ist es eine ungestörte Ausübung der Religion, wenn sogar die Einweihung erst dank dem Schutz von Tausenden von Polizisten stattfinden darf? Können Juden sich auch außerhalb der Synagoge als Juden zeigen? Ist die zentrale Lage Zeichen einer Verankerung oder einer Konfrontation? Wirkt die architektonische Umsetzung tatsächlich strahlend und einladend?
Ja: Wir können nicht warten, bis alle Antisemiten umerzogen worden sind. Die Einweihung findet unter Schutz statt, was soll daran schlimm sein? Juden sind da und brauchen unsere Unterstützung. Angesichts der Besorgnis um die Sicherheitslage passt doch auch die kubische Form so gut. Schon zum zweiten Mal ausgewählt, ist sie möglicherweise stilbildend. Warum eigentlich nicht? Dresden und München – das sind zwei großartige Beispiele, fast ausnahmslos positiv bewertet von Fachleuten. Ihnen wird bald die Synagoge in Bochum folgen.
Ja, aber: Dann machen Sie also zuerst den Zugang zur Synagoge kaum passierbar und nennen es einladend? Wie kann eine Festung, eine Burg, mit allen erkennbaren Merkmalen nicht zu übersehender hoher Absicherung, gleichzeitig einladend wirken?
Ja: Die Lage ist nun mal so, außerdem beziehen wir uns auf die Form des ursprünglichen Tempels in Jerusalem und betonen auf diese Weise den traditionsbewussten Charakter des Judentums.
Ja, aber: Moment, woher nehmen Sie den hermetisch abgeriegelten Kubus? Ich sehe in den zugänglichen Rekonstruktionen und Modellen Züge einer Verteidigungsanlage mit einer Kapelle - unterstützt von zwei Säulen an der Fassade. Somit passte sie sich an die Zeit der Entstehung an – ägyptische bis hellenistische Antike.
Ja: Das wissen wir doch besser. Der Tempel war eine Festung. Kein Zufall, dass eine Schutzwand noch übrig geblieben und als Klagemauer bekannt ist. Auf zahlreichen Gemälden wird diese Festung auch als massiver Kubus dargestellt.
Ja, aber: Meinen Sie die nachgemalten Szenen der Tempelzerstörung? Diese Burgen in der Malerei symbolisieren die seit je in der christlichen Kultur sitzende Überzeugung, die jüdische Gemeinde distanziere sich von der Umgebung: So kapseln sie sich ja ab. So ein Klotz wie in München oder Dresden drückt das ohne Worte schon wieder aus. Das bezeugen auch viele Stimmen aus der Bevölkerung. Soll das die wahre Tradition des Judentums sein?
Ja: So meinen wir das nicht. Wir möchten unseren Respekt vor der jüdischen Religion betonen, wir zeigen zum Beispiel auch das ewige Licht, welches nun abends und nachts erkennbar ist, für jeden, der am Gebäude vorbei kommt.
Ja, aber: Meinen Sie das Licht des Allerheiligsten im Tempel, welches auch der Hohepriester nur einmal im Jahr zu sehen bekam?
Ja: Auf diese Weise machen wir den jüdischen Glauben zugänglich.
Ja, aber: Man darf anzweifeln, ob es theologisch gesehen so richtig ist. Und was ist mit der Ausrichtung des gesamten Projektes auf die russischen Juden? Wie viele von ihnen leben ihre Religion? Gehen Sie davon aus, dass der Synagogenraum jeden Schabbat voll ist, nicht nur bei den Führungen am Tag der offenen Tür?
Ja: Klar. Und wenn die Erwachsenen diese ihre Aufgabe noch nicht voll übernehmen, dann werden es deren Kinder auf jeden Fall tun. Wir bauen, um sie zu integrieren. Es ist eine Investition in die Zukunft.
Ja, aber: Eine stolze Investition. Mehrere Millionen werden ausgegeben, um die Zukunft durch eine rosarote Brille anzuschauen. Wie ist es denn mit den Investitionen für heute? Warum soll am Anfang eine superteure Bauanlage stehen und nicht ein Integrationsprogramm? Kommen die Immigranten in die Synagoge, weil diese so schön, strahlend und einladend wirkt oder weil sie in die Gemeinschaft der Juden in Deutschland integriert worden sind?
Ja: Da wird doch einiges getan, was zugegebenermaßen nicht so sichtbar ist. Für die Integration der angekommenen Juden müssen wir jetzt allerdings nicht mehr so viel ausgeben wie früher, denn die Zahl der Kontingentflüchtlinge ist seit zwei Jahren stabil. Es kommen kaum neue, auch wenn es uns vor zwei Jahren anders versprochen wurde. Die, die schon da sind, werden einander schon irgendwie helfen. Damit kommen wir aber schon wieder vom Thema ab. Durch den Bau anspruchsvoller Gemeindezentren, die mit ihrer Umgebung kontrastieren, setzen wir ein weltweit sichtbares Zeichen. Genauso wie beim Jüdischen Museum und dem Mahnmal in Berlin.
Ja, aber: Darüber kann man auch anderer Meinung sein. Über den faktischen Stopp der Zuwanderung und die stotternde Integration erst recht, jetzt will ich mich aber auf die beiden Baubeispiele konzentrieren. Politiker und Medien können die Deutungen vorgeben, so viel sie wollen. Ein Gebäude spricht aber für sich. Das Mahnmal in Berlin erlebte inzwischen unzählige Deutungen, und doch sagt es etwas ganz Bestimmtes aus. Es sind mehrere Grabsteine, zwischen denen man geht, und mit dem Erlebnis der Begehung wird man konfrontiert. Beim etwaigen historischen Wissen und einer gewissen Empathie muss man sich unweigerlich vorstellen, dass es ein symbolischer Ort ist, stellvertretend für unzählige Tote der Nazizeit. Hätte der Architekt die Möglichkeit, würde er ganz Deutschland mit seinen Stelen bebauen. Insofern erfüllt das Mahnmal seine emotionale Aufgabe zu ermahnen. Die meisten Besucher verfügen allerdings nicht über die genannten Voraussetzungen und begehen den architektonischen Raum als Touristen oder Boulevardspaziergänger und nehmen seine rekreative Funktion wahr: Sie erholen sich beim Betreten und Begehen. Dies bringt Menschen zueinander und macht die ästhetische Komponente aus. Beide Blickwinkel geben dem Begehens- und Begegnungsort den speziellen kathartischen Sinn, anders als es auf einem Friedhof möglich wäre. Das Jüdische Museum in Berlin wirkt noch emotionaler. Ausstellungen müssen die unmittelbare Wirkung des gebrochenen Raums ständig überwinden und geraten damit immer wieder in einen beinahe vorprogrammierten Konflikt. Grundsätzlich wird hier dem Besucher die Lebenssituation eines KZ-Sträflings oder eines zum Tode verurteilten, auf die baldige Hinrichtung wartenden Menschen aufgezwungen, ohne Hoffnung, ohne Gnade.
Kann eine Synagoge als Bau das mittragen? Soll sie das? Soll sie ein unendlicher Stolperstein in der Zeit werden? Welche Geschichte soll sie, wenn überhaupt, verarbeiten? Die der jüdischen Diaspora? Die der deutschen Wahrnehmung der Shoa, gar des Judentums? Alle denken über die Zukunft nach, während es den Juden ein ureigenes Bedürfnis ist, über die Vergangenheit nachzugrübeln - etwa so?
Ja: Das ist zu viel hineininterpretiert. Eine Synagoge müsste ein Gebetshaus sein und an den Tempel erinnern. Das Monumentale der neuesten Bauten lädt zu einem Dialog mit der Geschichte ein, macht auf sich aufmerksam, will bewundert werden. Ein Jude freut sich in München doch, an seine Wurzeln erinnert zu werden - vor einer angedeuteten Klagemauer zu stehen, hebräische Buchstaben der zehn Gebote zu sehen, und zu gleicher Zeit auch ein unverkennbares Sicherheitsgefühl zu haben. Sogar der obere Kubus wird durch das Kupfergewebe wunderbar abgesichert, ohne zu stören. Man hat hier alles zusammen: Ein jüdisches Viertel inmitten der Großstadt.
Ja, aber: Dem muss ich widersprechen. Erstens brauchen Juden in Deutschland viel eher eine wahre Sicherheit. Zum Beispiel, Geschäfte mit koscheren Produkten, Restaurants, kurzum die selbstverständliche Möglichkeit sich als Juden zu zeigen, und das nicht nur im Gemeindezentrum. Das wird kaum angeboten, da die so genannte Sicherheitslage es nicht zulässt. Ein jüdisches Viertel ist doch etwas anderes als eine abgesicherte und in sich abgeschirmte Festung, gar ein Ghetto, nur platziert im Stadtzentrum. Heutige Juden wohnen irgendwo in einer Stadt zerstreut und zeigen sich normalerweise nicht als solche, nicht einmal durch eine Mesusa an ihren Türen. Ein israelischer Rabbiner wollte Juden in einer deutschen Stadt aufsuchen und ging umher in dem sicheren Glauben, deren Wohnungen an den Türpfosten erkennen zu können. Er fand keine und war traurig: „Wo sind Juden in dieser Stadt“? Zweitens gab es in Deutschland schon eine Bautradition für Synagogen, aus der Zeit vor 1933. Wenn ich mir Fotos und Zeichnungen von damals anschaue, kommt es mir so vor, als wären Synagogen mehr dem Stadtbild angepasst. Die einen bescheiden, die anderen eher pompös folgten dem Geschmack der Zeit und waren in direktem Sinne zeitgemäß, unter anderem auch als Ausdruck der kulturellen Assimilation und beiderseitigen Akzeptanz.
Außerdem zeigen einige hervorragende Beispiele moderner Synagogen, dass es auch ganz anders als in Dresden oder München geht. Die Cimbalista-Synagoge (Mario Botta) in Tel Aviv ist sehr monumental und dabei keine Festung, sie ist zwischen der Erde und dem Himmel gespannt und vermittelt deswegen eine geistige Bewegung nach außen, sie öffnet sich. Sie ist auch offen für Besucher, zeigt eine Distanz zwischen Mensch und Gott und doch teilt sie die Betrachter nicht in Auserwählte und Ausgeschlossene. Und schließlich gibt es Beispiele auch in Deutschland, wie die Arbeiten von Alfred Jacobi in Chemnitz und Kassel, von Zvi Hecker in Duisburg, das Projekt von Manuel Herz in Mainz, welches noch auf seinen Bau wartet. Dabei zeichnet die Stadt- und Umgebungsfreundlichkeit alle Arbeiten von Jacoby aus - bei deren Vielfalt fällt das auf. Seine Synagogen suchen keine Konfrontation, spielen sich nicht wie Festungen auf. Sind sie eher einladend zum Dialog?
Ja: Sehr wahrscheinlich, die elliptische Form in Tel Aviv und Chemnitz ist fließender als der Kubus. Schon klar. Auf mich wirken die Bauwerke von Jacobi aber viel zu harmonisch, zu angepasst, eben zu assimiliert. Der Komplex von Hecker in Duisburg ist im Gegenteil vielmehr hermetisch oder esoterisch: Wer kann sofort, ohne Kommentare erkennen, dass darin Buchstaben verehrt werden und auf die jüdische Wertung der Bücher hingewiesen wird? Ist es eine klarere Aussage? Eher ein Enigma.
Ja, aber: Hier zeigt sich aus meiner Sicht etwas ganz anderes: Die Synagoge in Duisburg dominiert nicht, sondern wird zu einem Teil des Gemeindezentrums. Diese einladende Tendenz betrachte ich als stilbildend. Noch stärker bekennt sich die von Holz für Mainz geplante Synagoge zur Verankerung in der Stadt, sie strahlt auch die logozentrische Begeisterung aus und zeigt sich trotzdem viel intimer, vertrauter.
Ja: Dann frage ich zurück: Wer entscheidet darüber, was gebaut wird? Architekten, Bauherren, Geldgeber? Wer bestimmt die Tendenz?
Ja, aber: Sie sind sehr wahrscheinlich alle unterschiedlicher Meinung. Einige Architekten sind dafür, die jüdische Besonderheit zu betonen. Die anderen neigen dazu, Juden einen sicheren Platz in dem deutschen Milieu zu geben. Sie laden somit Juden ein, sich inmitten der Stadt heimisch zu fühlen. Die Bauherren denken möglicherweise viel mehr über die Sicherheit nach, und die Geldgeber wollen eine klare politische Aussage, von der wir schon zur Genüge gesprochen haben. Was dabei herauskommt, ist das Resultat, welches wir nun verstehen wollen, nicht allerdings als die Summe der zum Teil gegensätzlichen Positionen, sondern als Ganzes. Denn dieses Resultat beschreibt nicht nur, wie die jüdische Geschichte in Deutschland wahrgenommen wird, sondern legt auch fest, wie die jüdische Gegenwart vernommen und gedeutet wird, und das - für die Zukunft. Ist die heutige jüdische Kultur über die bunte pluralistische Palette der gebauten Gemeindezentren zu verstehen oder nur über eine der hier skizzierten Tendenzen? Erinnert uns das an die internen Streitigkeiten zwischen den orthodoxen und liberalen Gemeinden? Sind wir imstande, anstatt zu streiten – einander anzuerkennen?
Ja: Der Deutung des Gebauten messen Sie hiermit eine besondere Rolle zu.
Ja, aber: Genau. Wenn Sie sagen, eine Festung steht da und lädt ein, haben Sie eine Beschreibung und eine Deutung zusammengebracht, die nicht unbedingt zueinander passen.
Ja: Wenn Sie auf diese Weise ständig Ihre Skepsis verbreiten, kann man doch gleich die Hände in den Schoß legen und nichts tun!
Ja, aber: Na-na, warum denn so aufbrausend? Müssen wir denn einer Meinung sein, sind wir so monolithisch? Gehen wir doch noch einmal Ihre Argumentation durch.
Ja: OK, wurde die Synagoge in Dresden (Wandel, Hoefer, Lorch+Hirsch) als die beste Europäische Architektur 2002 ausgezeichnet?
Ja, aber: Ja. Sie ist sehr beeindruckend und erinnert an die Shoa. Wir sind schon wieder dort, wo wir angefangen haben. Ist hier das Jüdische anders, fremdartig? Wollen wir diese Wirkung?
Ja: Ich würde lieber monumental sagen. Und darin ist sie wie auch die Münchner Synagoge den anderen genannten Beispielen weit überlegen. Warum denn wollen Sie immer so bescheiden wirken? Bekennen Sie sich doch zu Ihren Wurzeln!
Ja, aber: Darf ich das bitte auch außerhalb der Festung tun? Ohne Polizeischutz?